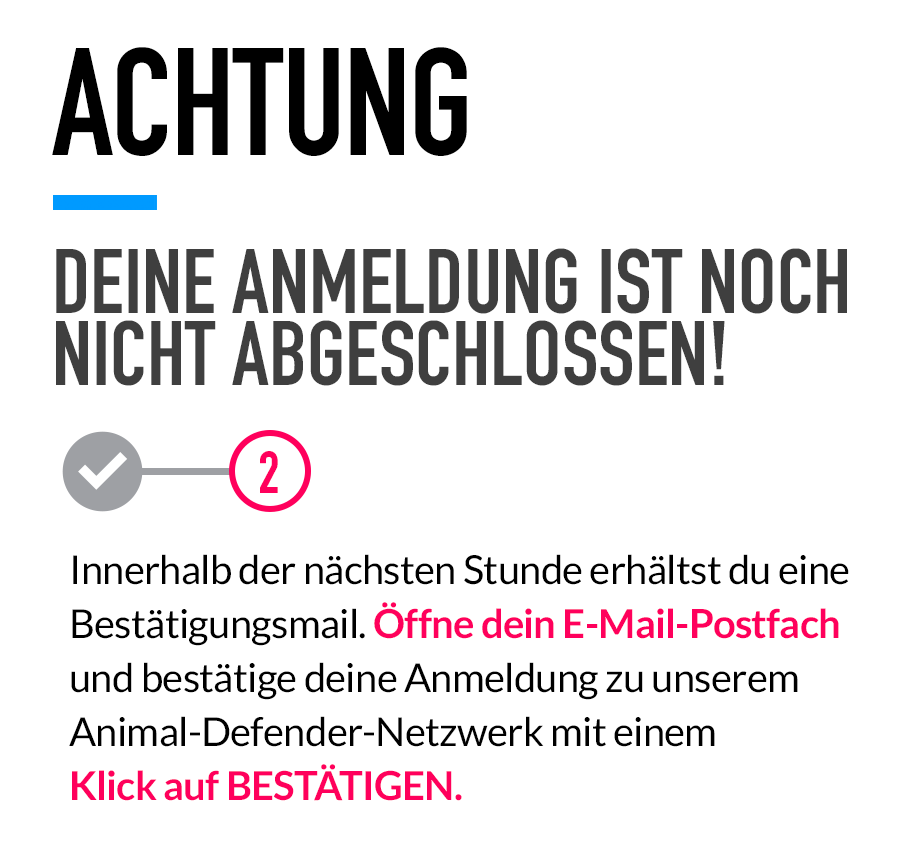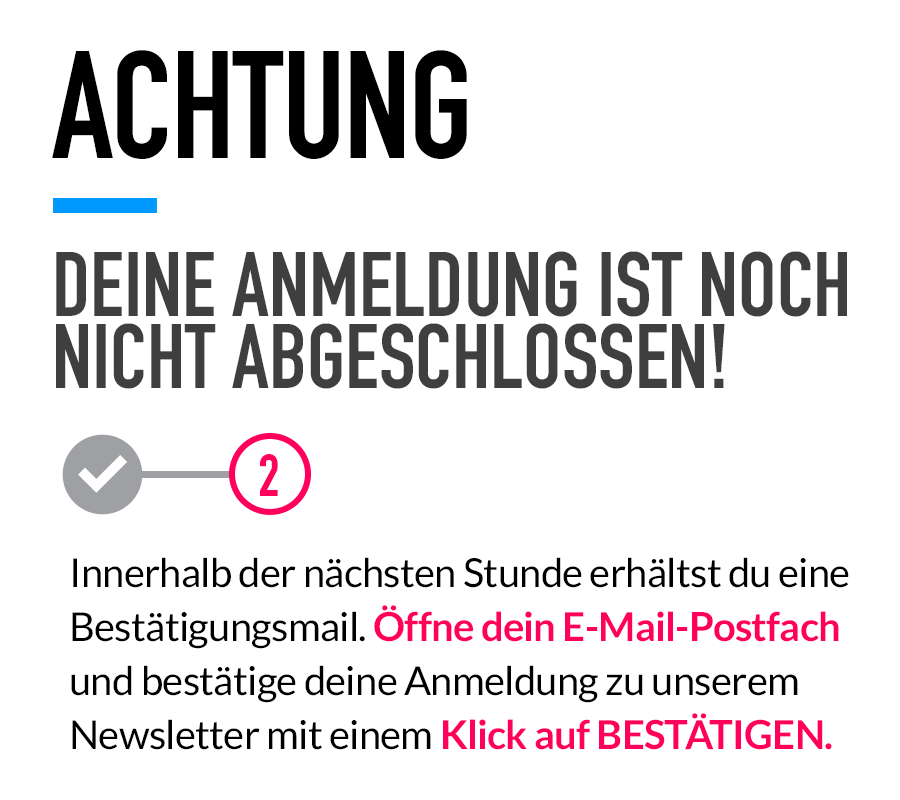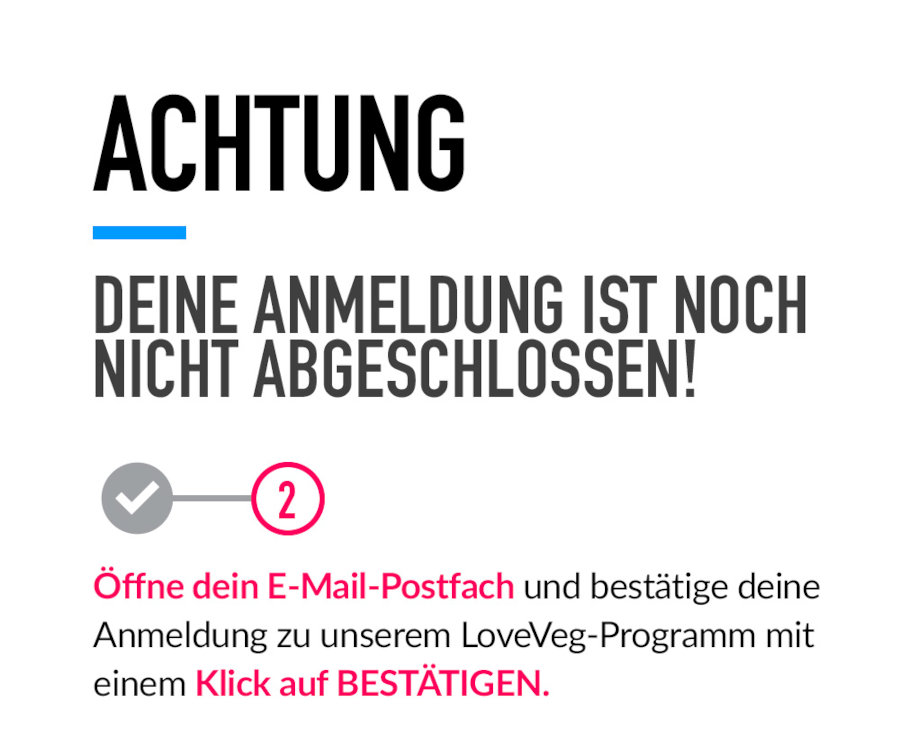Tierkörperbeseitigungsanlagen – was können sie uns über systematisches Leid der Tiere in der Landwirtschaft sagen?
Die Tierhaltungsindustrie zeigt uns fiktive Individuen, sie sind nicht echt. Immer wieder zeigt sie uns, wie gut es den Tieren in den landwirtschaftlichen Tierhaltungsbetrieben gehen muss: Abbildungen vereinzelter, glücklicher Rinder auf weitläufigen Wiesen; Illustrationen lächelnder Schweine auf einem Tiertransporter; Bilder von kleinen Hühnergruppen auf idyllischen Bauernhöfen.
Aus unserer jahrelangen Arbeit mit Undercover-Recherchen, auch in Deutschland, wissen wir, dass die Lebensbedingungen der Tiere in den Haltungsbetrieben ganz anders aussehen. Bis zu 98 % des Fleisches stammt von Tieren, die in die sogenannte „Massentierhaltung“ geboren werden1,2. 2021 wurden insgesamt fast 770 Millionen Tiere in deutsche Schlachthäuser transportiert und dort getötet3 – das sind im Schnitt mehr als 2 Millionen am Tag, etwa 24 pro Sekunde.
Dieser Artikel bezieht sich auf das Jahr 2021. Das Gesamtbild hat sich 2022 nicht wesentlich verändert: Es wurden insgesamt etwas weniger Tiere geschlachtet, der prozentuale Anteil „nicht zum Verzehr geeigneter Tiere“ blieb in etwa gleich. Unter dem Artikel haben wir die Zahlen von 2022 zum Vergleich hinzugefügt.
Reste von für den Verzehr getöteten Tieren werden in Tierkörperbeseitigungsanlagen weiterverarbeitet
Diese 770 Millionen Tiere sind tatsächlich Individuen und haben ihnen eigene Bedürfnisse. Sie werden von uns aber nicht wie Individuen behandelt. Sie werden wie Produktionsmittel behandelt, wie Gegenstände, die einen festen Produktionsablauf durchlaufen, bis nach vielen verschiedenen Schritten Teile von ihnen nach amtlichen Fleischuntersuchungen auf Tellern und andere Teile von ihnen in sogenannten „Tierkörperverwertungsanlagen“ oder „Tierkörperbeseitigungsanlagen“ landen.
In diesen Anlagen landen nämlich die sogenannten „Schlachtabfälle“, also Teile von getöteten Tieren, die nicht für den menschlichen Verzehr gedacht sind. Dort werden die Überreste der Tiere zu Mehlen, Fetten, Kohlen oder Schroten verarbeitet und im Anschluss als Dünger, Schmierfette oder Brennstoff genutzt.
Aber diese Anstalten geben allgemein auch einen anderen Blick auf die landwirtschaftliche Tierhaltung preis, der von der Industrie nur zu gerne verschwiegen wird. Um diesen Blick geht es in diesem Artikel.
Auch nicht zum menschlichen Verzehr geeignete Tiere landen in Tierkörperbeseitigungsanlagen
Denn ein nicht unerheblicher Teil der landwirtschaftlich genutzten und getöteten Tiere eignet sich aus verschiedenen Gründen nicht zum Verzehr. In der Regel haben diese Tiere entweder Krankheiten oder Verletzungen, die zu gesundheitlichen Risiken für Menschen führen könnten. Oder die Tiere sind schon an den Haltungsbedingungen gestorben, bevor sie in ein Schlachthaus gebracht wurden.
Doch nicht alle in amtlichen Schlachtuntersuchungen dokumentierten Krankheiten sorgen dafür, dass das Fleisch der Tiere nicht verkauft werden kann.
Nicht alle Krankheiten verhindern die Vermarktung des Fleisches der Tiere
Die amtlichen Schlachtuntersuchungen zeigen, dass 2021 über 2,5 Millionen Schweine zum Zeitpunkt ihrer Tötung an einer Lungenentzündung litten. Über 5 Millionen hatten eine „Parasitenleber“4 – also litten während ihres Lebens an einem Befall mit dem Schweinespulwurm. Der Befall mit diesem parasitären Fadenwurm löst eine Askaridose aus, die eine für Menschen „ungenießbare“ Leber zur Folge hat5.
Andere Erkrankungen haben zur Folge, dass das Fleisch der Tiere gar nicht mehr zum Verzehr verkauft werden darf.
Viele Tiere in der Landwirtschaft haben schwerwiegende Krankheiten, die ihr Fleisch „genussuntauglich“ machen
Deshalb wurden im letzten Jahr fast 115.000 Schweine nach ihrer Tötung aussortiert. Mehr als jedes dritte von ihnen hatte eitrige Ansammlungen oder Abszesse im Gewebe, mehr als jedes zehnte dieser Schweine hatte „Allgemeinerkrankungen“4. Das Fleisch weiterer fast 15.000 Schweine wurde nicht vermarktet, sondern entsorgt, weil „Schlachtschäden“ entstanden sind4, über 6.000 Schweine sind während ihres Transports gestorben6.
Bei anderen landwirtschaftlich genutzten Tieren sieht es auch so aus. Von fast 670 Millionen getöteten Hühnern wurden über 15 Millionen als „nicht zum Verzehr geeignet“ beurteilt4,6. Etwa über 4 Millionen von ihnen wiesen eine „tiefe Dermatitis“ auf (eine Hautentzündung, die oft durch Federpicken, Verletzungen und Stress entsteht7), über 2 Millionen litten an Aszites (Bauchwassersucht, die oft durch Sauerstoffmangel entsteht7). Diese Krankheitsbilder weisen also direkt auf schlechte Lebensbedingungen hin. Weitere 2,3 Millionen Hühner konnten aufgrund von „Schlachtschäden“ nicht vermarktet werden, über 800.000 überlebten ihren Transport nicht4,6.
Insgesamt starben 2021 in Deutschland 893.124 landwirtschaftlich genutzte Tiere in Transporten, 123.604 wurden gar nicht zur „Schlachtung“ zugelassen, aber dennoch getötet, 16.006.865 wurden als „genussuntauglich“ beurteilt6.
Sie alle landeten in Tierkörperbeseitigungsanlagen. Darüber hinaus wird geschätzt, dass in Bayern jedes fünfte Rind und jedes fünfte Schwein schon stirbt, bevor es überhaupt erst in ein Schlachthaus transportiert werden würde – ca. 220.000 Rinder, fast eine Million Schweine, und etwa zwei Millionen Hühner8. Regelmäßige Kontrollen der Tierkörper finden in Tierkörperbeseitigungsanlagen nicht statt.
Doch gerade diese Kontrollen wären besonders wichtig, weil sie Hinweise auf die Lebensbedingungen der Tiere in der Landwirtschaft geben.
Tiere in Tierkörperbeseitigungsanlagen sagen uns etwas über ihre „Haltungsbedingungen“
Die Daten über „genussuntaugliche“ Hühner geben bereits sehr deutlich Auskunft darüber, dass die Tiere unter schlechten Bedingungen gehalten wurden. Das schiere Ausmaß der Tiere, die während der Haltung vorzeitig sterben, deutet auf dasselbe hin.
Und auch eine wissenschaftliche Untersuchung von Rindern, die vorzeitig getötet und in Tierkörperbeseitigungsanlagen gebracht wurden, hat gezeigt, dass über 80 % der Rinder körperlich auffällig waren. Die meisten von ihnen hatten mehrere Verletzungen und Fehlbildungen, die in direktem Zusammenhang mit ihren Lebensbedingungen und der Zucht auf hohe Leistung stehen. Die meisten Tiere mit Verletzungen wiesen dabei mehrere gleichzeitig auf9.
Das hat zu politischen Forderungen geführt, zumindest nach strengeren Kontrollen in den Anlagen und einer besseren Rückverfolgbarkeit zu den Haltungsbetrieben. Für Paul Knoblach, Landtagsabgeordneter in Bayern, zeigen sich nämlich besonders in den Tierkörperbeseitigungsanlagen Probleme mit dem Tierschutz in der Landwirtschaft. Nur über systematische Änderungen könne man zu nachhaltig besseren Lebensbedingungen für Tiere in der Landwirtschaft gelangen8.
Das Leid nicht zum Verzehr geeigneter Tiere ist kein Zufall, es ist Teil des Systems landwirtschaftlicher Tierhaltung
Und ja: Krankheit, Verletzungen – und damit verbundene Schmerzen und andere Leiden – werden von der Tierhaltungsindustrie nicht nur billigend in Kauf genommen, sondern geduldet. Die „Verluste“, also das Fleisch kranker Tiere, das nicht verkauft werden kann, werden in den gesamten Produktionsprozess (denn nichts anderes ist landwirtschaftliche Tierhaltung) wirtschaftlich eingepreist.
Das liegt vor allem auch daran, dass niemand wirklich eine strafrechtliche Verfolgung befürchten muss, obwohl derartige Befunde an getöteten oder verstorbenen Tieren auf Verstöße gegen das Tierschutzgesetz hinweisen10,11. Die Strafrechtlerinnen Johanna Hahn und Prof. Dr. Elisa Hoven geben an, in der landwirtschaftlichen Hühnerhaltung gelte die „Faustformel“, dass es frühestens zu Ermittlungen gegen einen Betrieb kommt, wenn über 5 % der Tiere vorzeitig sterben10.
Ihrer Ansicht nach sei das Tierschutzrecht auf dem Papier zwar vergleichsweise streng. Es werde jedoch einerseits von den Behörden nicht ausreichend kontrolliert und wenn, dann werden mögliche Verstöße oft nicht an die Staatsanwaltschaften weitergegeben. Und bei Fällen, die tatsächlich doch bei Staatsanwaltschaften landen, würden die Verfahren regelmäßig eingestellt. Von 150 untersuchten Verfahren wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz, führten nur 11 überhaupt zu einem Urteil10,11.
Hahn und Prof. Dr. Hoven kommen zu dem Schluss, dass Tierquälerei in der landwirtschaftlichen Tierhaltung kaum strafrechtlich verfolgt wird und fordern eine Reform des Tierschutzrechts11.
Während momentan ein konkreter Nachweis für „länger anhaltende oder sich wiederholende erhebliche Schmerzen oder Leiden“ eines Tieres (§ 17 TierSchG, Abs. 2b12) erbracht werden muss, sollte sich ihrer Ansicht nach das Recht eher an der Einhaltung von Vorschriften bezüglich der Tierhaltung orientieren. Dabei sollte angenommen werden, dass ein Verstoß gegen diese Vorschriften automatisch zu Tierleid führt und deswegen strafbar ist10,11.
Das wäre ein wirksames Mittel, besonders gegen systematische Verstöße und systematisches Leid in der Tierhaltung vorzugehen, die durch die Erkenntnisse aus Tierkörperbeseitigungsanlagen offensichtlich sind.
Die Zahlen von 2022
Im Jahr 2022 wurden weniger Tiere getötet als 2021: etwas mehr als 750 Millionen Tiere, darunter über 700 Millionen Hühner13.
Insgesamt 12,1 Millionen Hühner wurden als „genussuntauglich“ eingestuft14, davon
- über 4 Millionen Hühner mit Hautentzündungen im Bereich des unteren Bauchs oder der Kloake (sogenannte tiefe Dermatitis)14
- über 2 Millionen Hühner mit Bauchwassersucht (häufig eine Folge von Sauerstoffmangel)14.
Weitere 1,6 Millionen Hühner wurden wegen „Schlachtunfällen“ nicht mehr zum Verzehr freigegeben14.
Außerdem wurde insgesamt 105.800 Schweine also „genussuntauglich“ gekennzeichnet14, davon
- 34.300 Schweine mit multiplen Abszessen (Eiter in ihrem Gewebe)14
- 14.900 Schweine, bei denen die Prüfer*innen aufgrund des Geruchs, der Farbe oder der Konsistenz das Fleisch der Tiere nicht zum Verzehr freigegeben haben14.
Bezogen auf bei getöteten Schweinen festgestellten Krankheiten wurden bei
- 4,3 Millionen Schweinen (etwa 10,2 % der getöteten Tiere!) eine sogenannte Parasitenleber festgestellt, die entsteht, wenn die Tierei im Laufe ihres Lebens mit Schweinespulwürmern infiziert waren14.
- Und 2,3 Millionen Schweinen (etwa 5,4 % der getöteten Tiere!) hatten zum Zeitpunkt ihrer Schlachtung eine Lungenentzündung14.
Die Zahlen sprechen nach wie vor für katastrophale Lebensbedingungen in der landwirtschaftlichen Tierhaltung.
Was du gegen das Leid tun kannst
Als Konsument*innen haben wir die Möglichkeit und Macht, frei über unsere Ernährung zu entscheiden. Wenn du dich für eine tierfreundliche Ernährung entscheidest, übernimmst du Verantwortung für die Tiere in der Landwirtschaft. Denn bei einer pflanzenbasierten Ernährung muss kein Tier für deinen Konsum leiden. Dabei können wir auch Vorbilder für andere sein und die Nachfrage nach tierischen Produkten senken.

Hilf der Neugierde
Schweine sind überaus soziale Tiere, die sehr interessiert an ihrer Umgebung sind. Du kannst diese neugierigen Tiere schützen, indem du dich einfach für pflanzliche Alternativen entscheidest.
Was du noch tun kannst
Du kannst dich auch gemeinsam mit uns und vielen anderen Menschen gegen die industrielle Tierhaltung aussprechen.
Bitte unterzeichne unsere Petition und fordere gemeinsam mit uns Unternehmen und Gesetzgebung auf, dringend ihre Unternehmenspolitik zu ändern und Gesetze zu erlassen, die zur Abschaffung der industriellen Tierhaltung führen.
Wir werden deine Unterschrift – zusammen mit allen anderen Unterschriften – an die Bundesregierung überreichen und sie daran erinnern, ihrer selbst zugeschriebenen Vorreiterrolle in Sachen Tierschutz gerecht zu werden. Damit unterstützt du uns, aktiv die Interessen der Tiere zu vertreten und die industrielle Tierhaltung in Deutschland zu beenden.
Quellen:
1https://www.geo.de/natur/oekologie/3331-rtkl-massentierhaltung-herzinfarkt-auf-dem-bauernhof
2https://www.tierschutzbuero.de/anteil-massentierhaltung/
3https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/02/PD22_050_413.html
4https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/06/PD22_234_413.html
5https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/askaridose.html
6https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=0&levelid=1658328957352&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&code=49911-0010&auswahltext=&werteabruf=Werteabruf#abreadcrumb
7https://www.forfarmers.de/geflugel/news-und-tipps/hohe-verwurfe-vermeiden.aspx
8https://www.zeit.de/news/2022-06/04/20-prozent-der-kuehe-und-schweine-verenden-vor-schlachtung
9https://oa-fund.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/69/
10https://www.zeit.de/2022/28/tierquaelerei-nutztiere-haltung-kriminalitaet
11https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/tierschutz-tierquaelerei-nutztiere-strafrecht-tierschutzgesetz-sanktionen-verfolgung/
12https://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html
13https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/02/PD23_051_413.html
14https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/06/PD23_240_413.html
Empfohlen