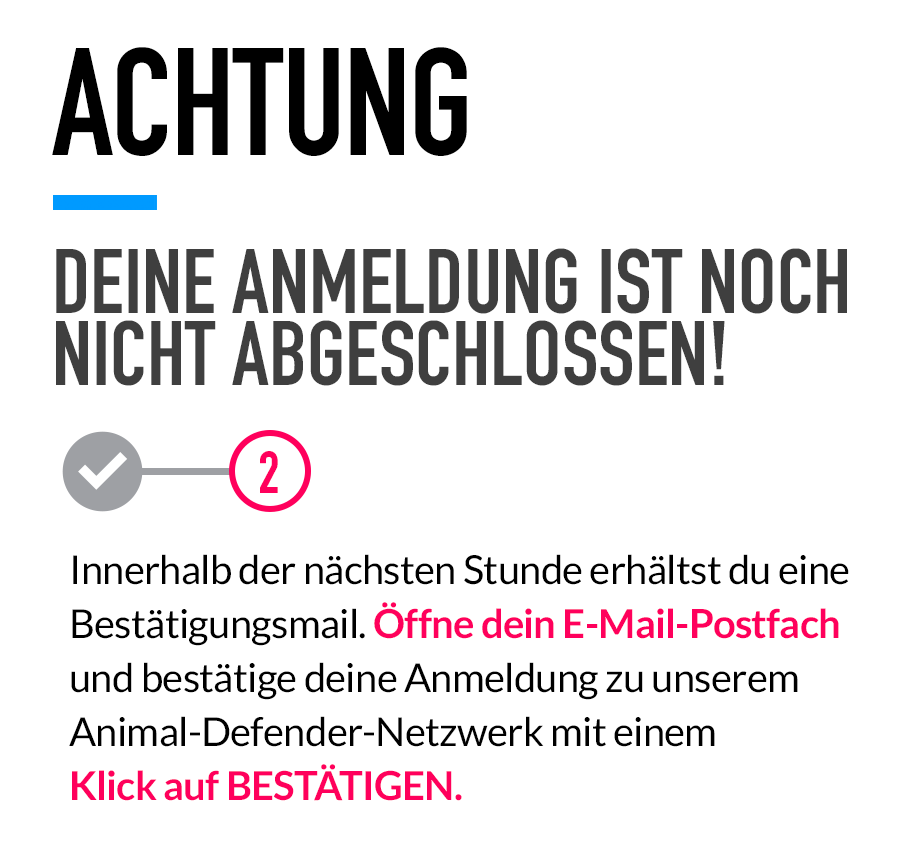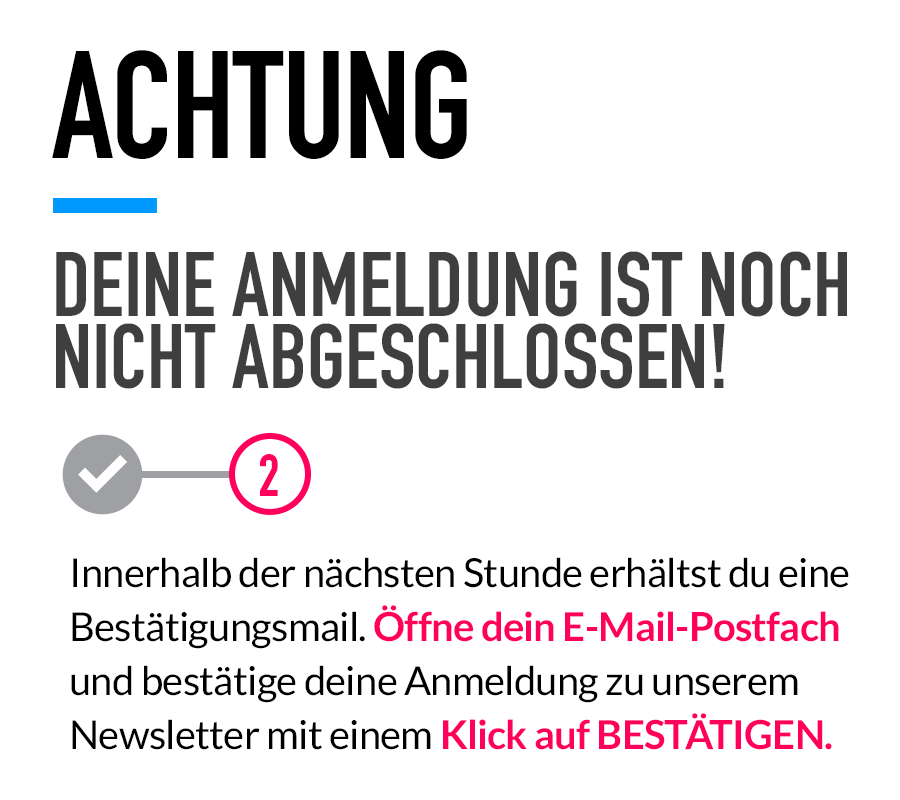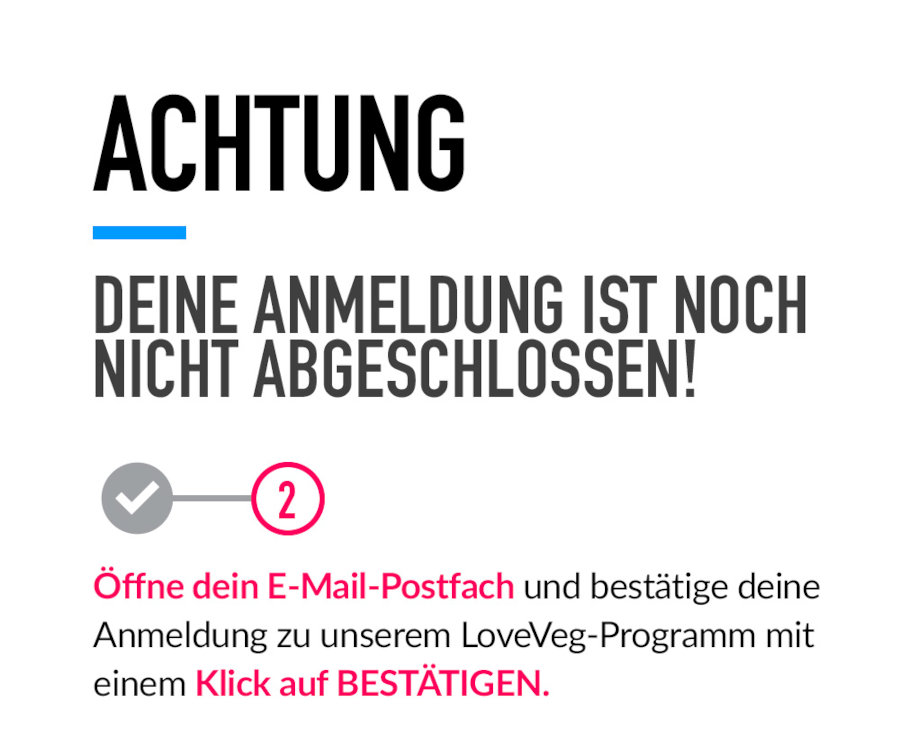Tierschutzorganisationen fordern Kükentötenverbot im EU-Parlament


18 europäische Tierschutzorganisationen, darunter Animal Equality, haben sich zusammengeschlossen, um im Europäischen Parlament eine neue Gesetzgebung zum Verbot der Tötung männlicher Küken zu fordern. Jedes Jahr werden in Europa 300 Millionen Küken geschlachtet, weil sie für die Eierindustrie keinen Wert haben.
Die Europäische Kommission wird noch in diesem Jahr einen neuen Gesetzesvorschlag zum Tierschutz vorlegen. Die Organisationen hoffen, dass der Vorschlag ein EU-weites Verbot der Tötung männlicher Küken enthalten wird. Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und Österreich haben diese Praxis bereits verboten.
Die Forderung nach einem EU-weiten Verbot des Kükentötens haben Animal Equality und die 18 weiteren Tierschutzorganisationen auf einer von L214, einer französischen Tierschutzorganisation, und dem Europäischen Institut für Tierrecht und Tierpolitik („European Institute for Animal Law and Policy“) organisierten Veranstaltung im EU-Parlament gestellt.
Unterstützt wurde die Veranstaltung von Abgeordneten wie Niels Fuglsang (S&D, Dänemark), Francisco Guerreiro (Grüne/EFA, Portugal), Sirpa Pietikäinen (EVP, Finnland) und Michal Wiezik (Renew, Slowakei) sowie von Expert*innen für Tierschutz und technologische Alternativen für das Kükentöten.
Alle Teilnehmer*innen sprachen sich dafür aus, dass die Tötung männlicher Küken in der Eierindustrie unethisch ist und verboten werden muss.




Jedes Jahr werden in Europa 300 Millionen Küken am Tag ihrer Geburt geschlachtet, weil sie für die Eierindustrie nicht „profitabel“ sind. Sie legen keine Eier und gehören zu langsam wachsenden Zuchtlinien, die für die Produzent*innen von Fleisch von Hühnern unrentabel sind.
Das Ziel dieser Veranstaltung ist es, die Europäischen Institutionen zu mobilisieren, damit die Tötung von Küken wirklich ein Ende nimmt. Bis ein EU-weites Verbot verhängt wird, können die Mitgliedstaaten nationale Verbote verhängen, wie es Frankreich derzeit tut, während sie die Tötung von Küken anderswo weiterhin erlauben. Bürger*innen fordern strenge Verbote ohne Ausnahmen, um derart grausamen Praktiken wirklich ein Ende zu setzen.
Brigitte Gothière, Mitbegründerin von L214
Einige Länder haben diese Praxis bereits verboten, wie Deutschland – wo sie seit Ende 2021 nicht mehr erlaubt ist – und Österreich, Luxemburg und Frankreich. Auch in Italien hat der Kongress im letzten Sommer nach einer intensiven Kampagne von Animal Equality mit großer Mehrheit beschlossen, die routinemäßige Tötung von Küken zu verbieten.
Das Verbot des Schlachtens von Küken war ein historischer Durchbruch in Italien, der nun auf die gesamte Europäische Union ausgeweitet werden muss. Tiere sind empfindsame Wesen, Individuen, die nicht wie Industrieabfall betrachtet werden dürfen. Die Europäischen Institutionen müssen sich in ihrer neuen Gesetzgebung einem Verbot verpflichten und die schrittweise Einführung von Technologien unterstützen, die diesem grausamen und systematischen Abschlachten ein Ende setzen können.
Matteo Cupi, Vizepräsident Europa, Animal Equality
Ein neuer Vorschlag für die Tiergesetzgebung im Jahr 2023
Die Europäische Kommission wird 2023 einen neuen Gesetzesvorschlag zum Tierschutz in der EU vorlegen. Tierschutzorganisationen hoffen, dass er unter anderem ein EU-weites Verbot des Kükentötens enthalten wird.
Die für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit zuständige EU-Kommissarin Stella Kyriakides kündigte im Oktober letzten Jahres an, dass die Europäische Kommission einen Vorschlag vorlegen wird, um die „beunruhigende“ Praxis der systematischen Tötung von männlichen Küken in der gesamten EU zu beenden.
Es bleibt jedoch noch einiges zu tun. Die Gegner einer Änderung argumentieren, dass die Eindämmung steigender Preise und der Inflation dem Tierschutz vorgezogen werden muss – weil Eier durch das Verbot teurer werden würden. Das wären wenige Cents pro Ei. Im Februar 2022 lehnte das Europäische Parlament bei der Abstimmung über den Umsetzungsbericht zum Tierschutz in landwirtschaftlichen Betrieben einen Änderungsantrag für ein Verbot des Schlachtens von Küken ab.
Die Technologie, die das Schlachten von Küken verhindert, gibt es bereits
Die wachsende Ablehnung des Kükentötens in der Bevölkerung in den vergangenen Jahren hat die Suche nach technologischen Alternativen beschleunigt. Und den Fortschritt vorangetrieben, der jetzt Realität ist.
Die technologische Alternative zum Kükentöten wird In-Ovo-Sexing genannt. Mit der Technologie ist es möglich, das Geschlecht des Hühnerembryos bereits im Ei zu bestimmen. Auf diese Weise werden die Eier, aus denen männliche Küken entstehen würden, aussortiert und nicht weiter bebrütet.
Das Schlachten von männlichen Küken ist eine der grausamsten Praktiken in der landwirtschaftlichen Tierhaltung. Dank des technologischen Fortschritts ist die systematische Tötung von Küken heute jedoch auch eine überholte – und selbst für die Industrie, die sie fortführen will, unnötige – Praxis.
Küken zu töten, wurde zum 01.01.2022 in Deutschland verboten.
Es liegen jedoch kaum Daten darüber vor, was mit diesen Küken jetzt geschieht. Es bleibt also noch unklar, was für Folgen das Verbot in Deutschland für die Küken wirklich hat. Wir drängen darauf, diese Küken nicht der Grausamkeit der landwirtschaftlichen Tierhaltungsindustrie auszusetzen.

Wähle MiTGEFÜHL
Hühner sind neugierige Tiere, die enge Bindungen zu anderen Tieren aufbauen und sich nachweislich in andere Hühner einfühlen können. Schütze diese sensiblen und sozialen Tiere, indem du dich für pflanzliche Alternativen entscheidest.