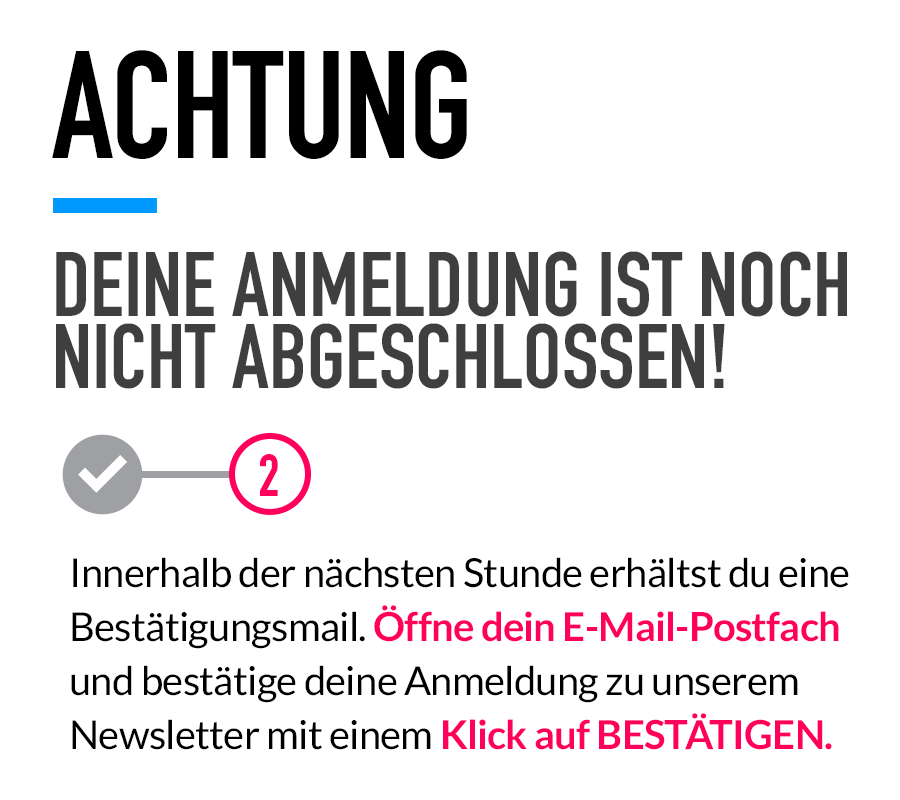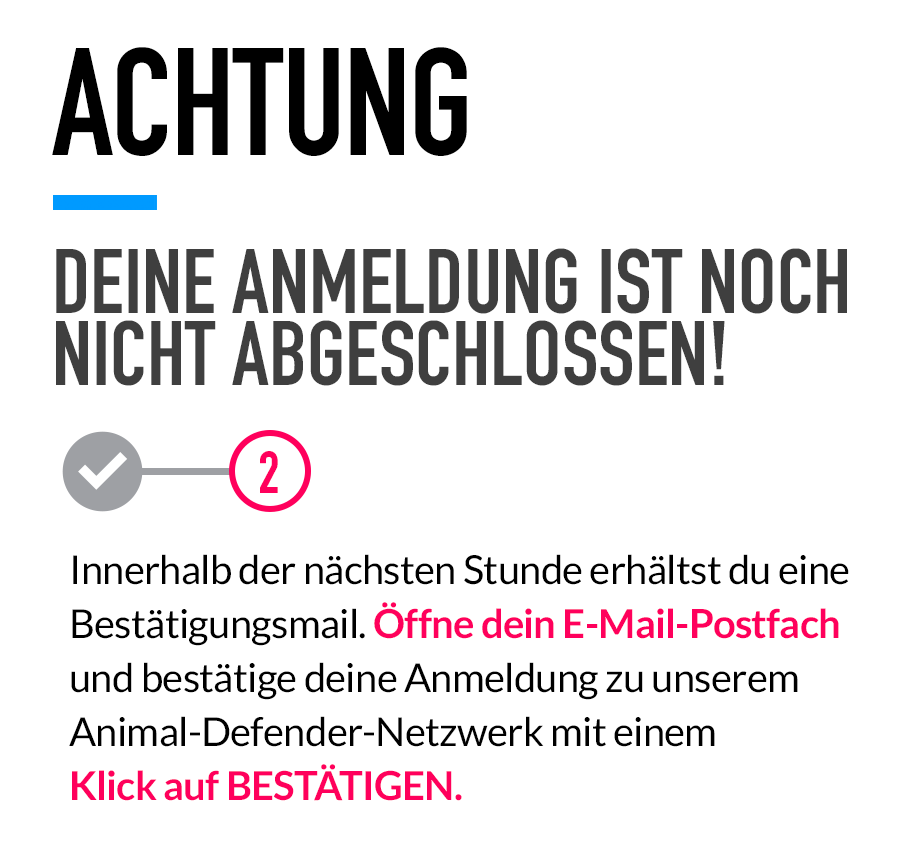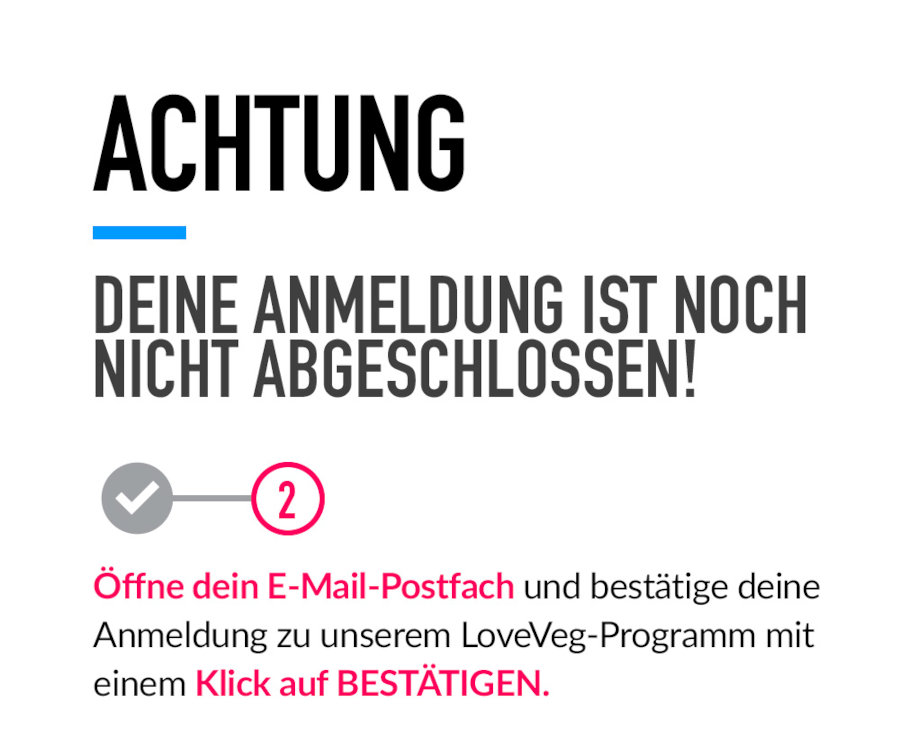Normenkontrollantrag: Die Haltungsbedingungen von Schweinen sind tierschutzwidrig


In dem eingereichten Normenkontrollantrag wird kritisiert, dass die gesetzlichen Mindestanforderungen bei der Haltung von Schweinen nicht mit dem Tierschutzgesetz vereinbar sind und dringend überprüft werden müssen. Insbesondere die mehrwöchige Fixierung von weiblichen Schweinen in Kastenständen, das geringe Platzangebot, Spaltenböden, Fütterungspraktiken, mangelhafte Beschäftigungsmöglichkeiten und unzureichende Schadgas-Grenzwerte sollen auf ihre Verfassungsmäßigkeit kontrolliert werden.
Das Land Berlin hatte den Normenkontrollantrag bereits 2019 beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Doch noch immer wurde keine Entscheidung getroffen.
Der Ausgang dieses Verfahrens hat Einfluss auf das Leben von Millionen Schweinen
Sollte das Bundesverfassungsgericht dem Normenkontrollantrag zustimmen, muss die Bundesregierung die gesetzlichen Verordnungen überprüfen und gegebenenfalls anpassen.
Bei Erfolg könnten langfristig tierschutzwidrige Praktiken bei jährlich rund 45 Millionen Schweinen in Deutschland beendet werden. Das wäre ein Meilenstein für den Tierschutz in Deutschland!
Was du jetzt sofort für Schweine und alle anderen landwirtschaftlich genutzten Tiere tun kannst, ist, dich konsequent pflanzlich zu ernähren. Entdecke auf Love Veg beispielsweise diese 7 schweinefreundlichen Rezepte.
Wir setzen uns für eine Welt ein, in der alle Tiere vor Ausbeutung geschützt sind. Doch auf dem Weg dahin dürfen wir die Tiere nicht vergessen, die in diesem Moment in diesem grausamen System leiden und in naher Zukunft noch in die landwirtschaftliche Industrie hineingeboren werden. Gesetzliche Veränderungen können für Millionen Tiere wichtige Verbesserungen bedeuten.
Warum die Haltungsbedingungen verfassungswidrig sind
Die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) legt die Anforderungen der Tierhaltung fest. Der Normenkontrollantrag kritisiert, dass die aktuellen Vorgaben dieser Verordnung aber zu erheblichen Schmerzen, Leiden und Schäden bei den Schweinen führen, und fordert daher strengere und tiergerechtere Regelungen. Das Land Berlin bemängelt dabei insbesondere folgende Praktiken und hält sie für nicht mit dem im deutschen Grundgesetz verankerten Staatsziel Tierschutz vereinbar:
Kastenstandhaltung von weiblichen Schweinen

Aktuelle Situation: Noch immer müssen Millionen Mutterschweine im Durchschnitt mehr als 5,5 Monate im Jahr in Kastenständen fristen. Die Tiere sind bis zur fast vollständigen Bewegungslosigkeit eingezwängt, was zu erheblichen Schmerzen, vermeidbaren Leiden und Schäden führt. Unter anderem werden das Grundbedürfnis nach Schlaf und ungestörter Ruhe sowie der Sozialkontakt größtenteils verhindert. Diese Haltungsbedingungen sollen mit der Änderung der TierSchNutztV vom Februar 2021 stark reduziert werden. Ab 2029 wird die Kastenstandhaltung im Deckzentrum komplett verboten. Im Abferkelbereich dürfen die weiblichen Schweine ab 2036 nur noch maximal fünf Tage um den Zeitraum der Geburt in einem Kastenstand gehalten werden.
Kritik: Der Normenkontrollantrag kritisiert die langen Übergangsfristen. Außerdem bemängeln die Antragssteller*innen unter anderem fehlende Regelungen. Beispielsweise darf die ungehinderte, gestreckte Seitenlage der Tiere im Kastenstand zwar nicht durch bauliche Hindernisse eingeschränkt werden, aber andere Einschränkungen sind theoretisch zulässig. In der Praxis sind die Kastenstände meistens direkt nebeneinander aufgestellt und das seitliche Hinlegen kann durch die Nachbartiere behindert werden. Auch durften Tiere früher bei offensichtlich erkennbarer nachhaltiger Erregung – also wenn sie sehr unruhig wurden – nicht im Kastenstand belassen werden. Dieser Abschnitt wurde mit der Übergangsregelung gestrichen beziehungsweise bezieht sich nur noch auf den 5-Tages-Zeitraum rund um den Geburtsvorgang.
Forderung: Die Kastenstandhaltung soll langfristig komplett abgeschafft werden und kurzfristige Verbesserungen müssen umgesetzt werden. Das bedeutet mehr Platz, damit die Tiere wirklich ungehindert ausgestreckt auf der Seite liegen können, und sie sollen auch die Möglichkeit haben, Liege-, Kot- und Aktivitätsbereiche voneinander zu trennen sowie weitere Grundbedürfnisse erfüllen zu können.
Zu wenig Platz in der Gruppenhaltung

Aktuelle Situation: Ferkel werden in der Regel nach drei bis vier Wochen von der Mutter getrennt. Während der Aufzucht und in der Mast werden die Tiere in Gruppen gehalten, bis sie mit etwa sechs Monaten getötet werden. Und auch weibliche Schweine in der Zucht verbringen etwa das halbe Jahr zusammen mit anderen Artgenossen. Für die verschiedenen „Schweine-Kategorien“ sind in der TierSchNutztV unterschiedliche Mindestflächen vorgeschrieben.
Kritik: Die vorgeschriebenen Mindestflächen sind zu gering und entsprechen nicht den Empfehlungen des Wissenschaftlichen Veterinärausschusses der EU. Die Schweine können sich nicht frei bewegen und ungestört ruhen. Unzureichender Platz begünstigt Stress, Rangkämpfe und Verhaltensstörungen. Es ist auch keine räumliche Trennung von Liege-, Kot- und Aktivitätsbereichen möglich.
Forderung: Der Normenkontrollantrag fordert eine deutliche Vergrößerung der Mindestflächen und verbindliche Vorgaben, die sich an den wissenschaftlichen Empfehlungen zum Platzbedarf orientieren.
Betonspaltenböden und Liegebereiche ohne Einstreu

Aktuelle Situation: Die TierSchNutztV lässt die Haltung von Schweinen auf hartem, blankem Betonspaltenboden ohne Einstreu zu. Für Schweine in Gruppenhaltung ist ein perforierter Liegebereich der Regelfall.
Kritik: In der deutschen Verordnung sind weder das Bequemlichkeitsgebot noch das Schädigungsverbot für den Liegebereich, wie sie in EU-Richtlinien und Empfehlungen des Ständigen Ausschusses genannt werden, ausreichend umgesetzt. Die Tiere müssen einen Großteil ihrer Lebenszeit auf dem harten Boden liegen, was häufig zu schweren Verletzungen führt. Dadurch, dass keine Trennung von Liege-, Kot- und Aktivitätsbereichen möglich ist, kommen die Schweine ständig in Kontakt mit Kot und Urin, was Wunden verursacht und verschlimmert. Das stetige Einatmen von Ammoniakgasen löst Lungenschäden, Husten und andere Krankheiten aus. Auch psychisch ist die Situation sehr belastend für die Tiere. Schweine haben ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Sauberkeit, und auch der emotional wichtige Nestbau ist ihnen nicht möglich.
Forderung: Liege- und Kotbereich müssen klar räumlich voneinander getrennt sein. Die Liegebereiche müssen physisch und thermisch komfortabel sein und dürfen keine Verletzungen verursachen. Außerdem fordert der Normenkontrollantrag, dass Einstreu oder Liegematten verbindlich vorgeschrieben werden müssen.
Unzureichende Beschäftigungsmöglichkeiten

Aktuelle Situation: Die TierSchNutztV schreibt vor, dass jedes Schwein Zugang zu gesundheitlich unbedenklichem, organischem und faserreichem Beschäftigungsmaterial haben muss, das untersuch- und bewegbar sowie veränderbar ist und dem Erkundungsverhalten dient. In der Praxis steht den meisten Tieren kein Einstreu zur Verfügung und als Beschäftigungsmaterial dient oftmals lediglich ein hängendes Stück Holz.
Kritik: Die Bedingungen sind dramatisch, aus Frust und Stress beißen die Tiere oftmals in die Schwänze der anderen Tiere. Infolge dessen verstümmeln viele Betriebe mittels Ausnahmegenehmigung die Schwänze der Ferkel kurz nach der Geburt. Und genau das soll mit effektiven Maßnahmen verhindert werden, doch in der Praxis findet das kaum Anwendung. Das Erkundungs- und Wühlbedürfnis, das unter natürlichen Bedingungen einen Großteil der Tagesaktivität von Schweinen ausmacht, wird vollständig unterdrückt. Die Anforderungen an das Beschäftigungsmaterial sind zu allgemein. Die deutsche Verordnung bleibt hier hinter der EU-Richtlinie zurück, die konkrete Beispiele für durchwühlbares Material nennt. Einzelne, hängende Gegenstände (z. B. Holzbalken an Ketten) anzubieten, befriedigt das Wühlbedürfnis der Schweine nicht, da diese ihr Erkundungsverhalten auf den Boden richten.
Forderung: Das Beschäftigungsmaterial muss durchwühlbar sein, in ausreichender Menge am Boden ausgebracht werden und den qualitativen Vorgaben der EU-Richtlinie entsprechen (z. B. Stroh, Heu, Holz, Sägemehl, Pilzkompost, Torf). Damit könnte auch das Schwanzbeißen reduziert oder verhindert werden. Solche Maßnahmen müssen umgesetzt werden, bevor das Schwänzekürzen in Betracht gezogen wird.
Problematische Fütterung

Aktuelle Situation: In vielen Fällen wird die Fütterung rationiert und es gibt weniger Futterstellen als Tiere. Zudem findet häufig eine ausschließliche Fütterung von Brei, Suppe oder Mehl statt. Eine Raufuttergabe ist nur für Schweine vor dem Geburtstermin und junge trächtige Schweine vorgeschrieben.
Kritik: Die Regelungen zur Fütterung schließen die gleichzeitige Nahrungsaufnahme für alle Schweine einer Gruppe aus. Das verstößt gegen das Tierschutzgesetz sowie EU-Richtlinien und führt zu Rangkämpfen, Stress, Aggressionen und Verletzungen. Die fehlende Raufuttergabe ist unzureichend und entspricht nicht den physiologischen Bedürfnissen der Schweine und führt zu Magengeschwüren und Verdauungsstörungen. Die schnelle Futteraufnahme ohne strukturreiches Material verursacht außerdem Beschäftigungsdefizite und Verhaltensstörungen wie Stangenbeißen, Leerkauen, Schwanz- und Ohrenbeißen.
Forderung: Alle Schweine einer Gruppe müssen gleichzeitig Zugang zum Futter haben. Ebenso muss Raufutter (z. B. Stroh, Heu, Silage) als Ablenkfutter angeboten werden.
Schadgase und fehlende Thermoregulierung

Aktuelle Situation: Die TierSchNutztV legt Obergrenzen für die Gaskonzentrationen fest: Ammoniak 20 ppm, Kohlendioxid 3.000 ppm, Schwefelwasserstoff 5 ppm. Diese Werte „sollen nicht dauerhaft überschritten werden“. Es gibt keine Angaben zu Höchsttemperaturen oder Vorschriften für Abkühlvorrichtungen.
Kritik: Die Grenzwerte für Ammoniak (20 ppm) und Schwefelwasserstoff (5 ppm) sind zu hoch im Vergleich zu den EU-Empfehlungen (10 ppm Ammoniak, 0,5 ppm Schwefelwasserstoff). Die Formulierung „sollen nicht dauerhaft überschritten werden“ ist unzureichend und schwächt die rechtliche Verbindlichkeit ab, was eine effektive Kontrolle erschwert und temporäre Überschreitungen legalisiert. Erhöhte Schadgaskonzentrationen sind ein Hauptfaktor für Lungenschäden, Husten und Atemwegserkrankungen. Bis zu 92 Prozent der Schweine, die geschlachtet werden, zeigen Lungenschäden. Es fehlen außerdem konkrete Mindestanforderungen für die Verbesserung der Luftqualität und Abkühlungsmöglichkeiten (z. B. Zugang zu Wasser zum Baden oder Suhlen). Hohe Temperaturen und mangelnde Abkühlungsmöglichkeiten beeinträchtigen das Wohlbefinden und die Gesundheit der Schweine, da sie ihre Körpertemperatur nur begrenzt regulieren können.
Forderung: Niedrigere, strikt verbindliche Grenzwerte für Schadgase, orientiert an den Empfehlungen des Wissenschaftlichen Veterinärausschusses der EU. Verbindliche Vorschriften für Abkühlvorrichtungen (z. B. Wasser zum Baden, Suhlen) und wirksame Lüftungssysteme zur Reduzierung von Schadgasen. Die Möglichkeit zur räumlichen Trennung von Funktionsbereichen im Stall, um die Schadgasbelastung im Liegebereich zu verringern.

Hilf der Neugierde
Schweine sind überaus soziale Tiere, die sehr interessiert an ihrer Umgebung sind. Du kannst diese neugierigen Tiere schützen, indem du dich einfach für pflanzliche Alternativen entscheidest.